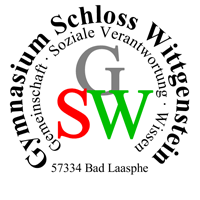- Details
Das Gymnasium praktiziert ein äußerst vielseitiges Fahrtenkonzept und wählt immer wieder besondere außerschulische Lernorte aus, um den Schülerinnen und Schülern Lerninhalte anschaulich zu vermitteln.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 haben die Gelegenheit mit ihren Fachlehrern eine mehrtägige Fahrt nach England zu unternehmen, so zum Beispiel nach Eastbourne, einem Seebad am Ärmelkanal in der Grafschaft Sussex. Während des mehrtägigen Aufenthaltes wohnen die Kinder in Gastfamilien und nehmen so am Familienleben im anderen Land teil. Sinn und Zweck dieser Fahrt ist es, den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen sowie Land und Leute eines fremden Landes kennenzulernen.
Zu den weiteren Exkursionen zählen
- Theater- und Kinobesuche z.B. in Marburg oder Bad Berleburg,
- Musicalbesuche im Kölner Musical-Dome,
- die Hochschulwoche in Berlin in Zusammenarbeit mit dem Institut für Physik der Humboldt-Universität für die Sek. II,
- Tagesexkursionen des Biologie- oder ChemieLeistungskurses,
- Exkusionen der Erdkunde-Kurse z.B. ins Bergbaumuseum Bochum oder nach Haus Düsse,
- eine einwöchige Berlin-Exkursion der Religionskurse (JS 10) zum Thema „Juden in Berlin“,
- die Kennenlerntage in der Sportschule Grünberg der Jahrgangsstufe 10,
- eine zweitägige Weimar-Buchenwald-Fahrt der Klassen 9,
- ein Besuch der Benediktiner-Abtei in Meschede (JS 8) u.v.m.
- Als Highlight der Oberstufe zählt die einwöchige Toscana-Fahrt der JS 12, bei der u.a. Florenz, Pisa und die Cinque Terre besucht werden.
- Details
Präventionsveranstaltungen
Im Rahmen unseres schulinternen Präventionskonzeptes arbeiten wir mit außerschulischen Partnern zusammen, z.B. der Kriminalpolizei und der Bundespolizei.
Es finden regelmäßige Präventionsveranstaltungen zu folgenden Themen statt:
- Kinder stark machen
- Gewaltprophylaxe
- Suchtvorbeugung
- Drogenprophylaxe
- Umgang mit den neuen Medien
- Sicherheit an Bahnhöfen und Bushaltestellen usw.
Es erfolgt so eine umfassende Aufklärung und Beratung, die Schülerinnen und Schüler vor Gefahren verschiedener Art schützen soll.
Krisenteam am GSW
 Überall gibt es mal Streit. Wir sind bemüht, durch frühes Gegenlenken und Schlichten Schlimmeres zu verhindern.
Überall gibt es mal Streit. Wir sind bemüht, durch frühes Gegenlenken und Schlichten Schlimmeres zu verhindern.
An unserer Schule steht uns ein dafür ausgebildetes Team von Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die als Streitschlichter und Anti-Mobbing-Team tätig werden und oft recht schnell und diskret helfen können.
Ansprechpartnerinnen am GSW sind Heike Ringler, Anne Wickel-Viehl und Christian Kienel.
Gesundheitstage
Akzeptiert man den Gesundheitsbegriff als vollkommene Einheit, so muss es das Bestreben des Menschen sein, diese Einheit aufrechtzuerhalten (Prävention).
Sollte sie krankheitsbedingt gestört sein, muss man im Rahmen der Diagnostik sehen, wie, wo und warum dies so ist, und im therapeutischen Sinne versuchen, sich dem Idealzustand Gesundheit soweit als möglich wieder anzunähern. Verantwortung für die eigene Gesundheit hat der Einzelne.
Verantwortung bei den 14-17jährigen Jugendlichen wecken, Fingerzeige geben und auf falsche Verhaltensmuster aufmerksam machen – diese Zielsetzung liegt der Veranstaltung zugrunde.
Als Kooperationspartner dabei sind das Jugendrotkreuz der Lahnstadt, die Drogen- und Suchberatung des Diakonischen Werkes, Ernährungsberater, Vertreter der Zahngesundheit, Krankengymnasten, Psychologen und die Barmer Ersatzkasse.
- Details
Studien- und Berufsorientierung – Übersicht
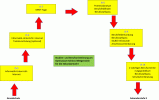 |
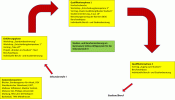 |
„Wir versuchen, unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten,“ so Schulleiter Christian Tang, „daher nimmt unsere Schule am Projekt der Landesregierung ‚KAoA’ (Kein Abschluss ohne Anschluss) teil.“ Dieses Programm ist modular aufgebaut und bietet von Klasse 8 bis Klasse 13 verschiedene Informationsblöcke an, die die spätere Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung erleichtern sollen.
 |
 |
 |
|
Einblicke in das Berufsleben gibt es bei den zahlreichen |
||
In Klasse 8 (G9) findet die für alle Schülerinnen und Schüler verbindliche eintägige Potenzialanalyse statt. In einem eintägigen Test und in Gruppenversuchen soll herausgefunden werden, ob die Stärken eher im technischen, im kommunikativen, im mathematischen oder im sozialen Bereich liegen. Bei der sogenannten Berufsfelderkundung haben die Neuntklässler (G9) dann an drei aufeinander folgenden Tagen Gelegenheit, drei unterschiedliche Unternehmen bzw. drei unterschiedliche Felder innerhalb eines Unternehmens (z.B. Verkauf, Entwicklung, Produktion) zu erkunden und zum ersten Mal in die Berufswelt hinein zu schnuppern.
 |
 |
 |
|
Ihre Praktika absolvierten Philipp Roth bei EJOT, Haogang Qu bei der |
||
In Klasse 10 (G9) folgt dann das zweiwöchige Schülerpraktikum. Hierzu suchen sich die Schülerinnen und Schüler selbst einen Praktikumsplatz für zwei Wochen und führen über dieses Praktikum ein verbindliches Berichtsheft, welches benotet wird. Ab Klasse 10 (G9: 11), der Einführungsphase in die Gymnasiale Oberstufe, nehmen die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Workshops und Informationsveranstaltungen teil (siehe Strukturdiagramm). Die Universität Siegen bietet das Projekt „Brücken ins Studium“ an, ein spezielles Angebot für Studieninteressierte. Zudem gibt es für interessierte Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Hochschulerkundungswochen die Möglichkeit die Universität Marburg zu besuchen.
 |
 |
Um den jungen Erwachsenen ein optimales Angebot zur Berufsorientierung zu geben und rechtzeitig die Weichen für die spätere Ausbildung zu stellen, hat das GSW Kooperationen mit der Technischen HochschuleMittelhessen (THM) und den Universitäten Marburg und Siegen geschlossen. Den Schülerinnen und Schülern steht ein Berufsorientierungsbüro, kurz „BOB“ genannt, zur Verfügung. Dort finden die Beratungsgespräche statt und die Schülerinnen und Schüler können sich mit Info-Material versorgen oder an einem von mehreren PCs selbständig im Internet recherchieren. Die StuBO-Koordinatorinnen am GSW sind Heike Ringler und Sabine te Heesen.
„Wir interessieren uns dafür, was mit unseren Schülerinnen und Schülern passiert, wenn sie die Schule verlassen,“ betont Schulleiter Christian Tang.
- Details
Bilingualer Bildungsgang
Was bedeutet eigentlich bilingual?
 Nach Genehmigung durch die Schulaufsichtsbehörde läuft am GSW seit dem 1. August 2014 ein bilingualer Unterrichtszweig.
Nach Genehmigung durch die Schulaufsichtsbehörde läuft am GSW seit dem 1. August 2014 ein bilingualer Unterrichtszweig.
Die Klassen 5 und 6 erhalten eine Zusatzstunde Englisch.
Ab Klasse 7 wird das Fach Politik und ab Klasse 8 das Fach Biologie schwerpunktmäßig auf Englisch unterrichtet.
Durch den verstärkten Englischunterricht und die Sachfächer auf Englisch wird die Fremdsprache schneller und besser erlernt.
Das Ergebnis des größeren In- und Outputs sind häufig bessere Leistungen im Fach Englisch.
Dadurch wird nicht nur die Kompetenz im Fach Englisch erweitert, die Schülerinnen und Schüler erhalten auf ihren Zeugnissen auch die Bestätigung eines bilingualen Bildungsganges, was ihnen später von Vorteil sein kann.
Wie wird bewertet?
Für die Leistungsbewertung im Fremdsprachenunterricht gelten die allgemeinen Lernanforderungen.
Wichtig: Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Noten für Politik und Biologie, nicht für ihre Fähigkeiten in Englisch. Auf den Zeugnissen steht „Politik bilingual“ als Name des Faches.
Was sind die Ziele?
Wir wollen die Weltsprache Englisch stärken!
Die englische Sprache ist in den letzten Jahren noch mehr als zuvor in vielen Bereichen der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik als Arbeitssprache die Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation geworden.
Auch Universitäten und Fachhochschulen haben sich durch kombinierte Studiengänge zwischen Sachfächern und Fremdsprachen sowie englischsprachige Seminarveranstaltungen und Leistungsnachweise diesem Prozess angeschlossen.
Eine gute Schule muss ihre Schülerinnen und Schüler auf diese Entwicklungen vorbereiten. Eine Möglichkeit hierzu bildet der sogenannte bilinguale Sachfachunterricht.
Die Fremdsprache wird somit zur Arbeitssprache.
Die Schülerinnen und Schüler lernen Sachverhalte aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Politik in der Fremdsprache zu verstehen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie in der Fremdsprache zu diskutieren.
Sie setzen sich mit den Inhalten auseinander und stellen Arbeitsergebnisse schriftlich sowie mündlich dar. Bilingualer Unterricht ist stark handlungs- und produktorientiert – wir erstellen Flyer, Poster, Präsentationen, Filme, blogs und andere Materialien in der Fremdsprache.
Bilingualen Unterricht erteilen Kathrin Graf (Biologie) und Anne Wickel-Viel (Politik).
Leichter lernen für eine globale Welt!
- Details
Das Gymnasium Schloss Wittgenstein freut sich über das Erreichen vieler Ziele in Entwicklung und Umsetzung des Medienkonzepts, welches die Schülerinnen und Schüler künftig nachhaltig zu einem bewussten und zielorientierten Handeln in der digitalen Welt befähigen soll.
EDV wird in den Klassen 5 und 6 bereits seit mehr als 15 Jahren unterrichtet. Zudem gibt es im Differenzierungs-Bereich das Wahlfach „Informatik“. Im Bereich der „Ausstattung“ müssen die notwendigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Vermittlung von Medienkompetenz geschaffen werden.
Hier wurden bereits gute Voraussetzungen geschaffen: Im Schloss ist ein Computerraum mit 13 fest installierten PC-Plätzen seit mehr als 10 Jahren vorhanden.
Ein Großteil der Klassenräume im Schulgebäude ist mit Activboards (PC, Beamer und Projektionstafel) seit nunmehr zehn Jahren ausgestattet.
Der Ausbau der Technik ist stetig aktualisiert worden, so dass alle Unterrichtsräume fest mit dem LAN verbunden sind, zudem ist seit dem Sommer 2018 ein professionelles WLAN-Netz in den beiden Gebäuden (Schule und Schloss) installiert worden. Damit ist ein Internetzugang von allen Stellen im Gebäude drahtlos gewährleistet.
 |
 |
|
| Im Computerraum des Schlosses | ||
 |
 |
|
In diesem Zusammenhang des gezielten Ausbaues der Digitalisierung sind 20 Laptops samt Laptopwagen und 50 iPads, ebenfalls mit Wagen, angeschafft worden.
Wir freuen uns sehr, dass der Schulträger eine Schullizenz von Microsoft Office 365 ProPlus erworben hat, so dass die Schülerinnen und Schülern kostenlos auf Standardsoftware wie Word, Excel und Powerpoint zurückgreifen können. Durch dieses besondere Angebot der Schule werden die Schülerinnen und Schüler früh vertraut mit den wichtigsten Programmen für Präsentationen, Textverarbeitung und Tabellenkalkulationen.
Für die Dauer der Schulzugehörigkeit kann dieser Service von allen Schülerinnen und Schülern abgefragt werden und unterstützt sie so bei der Erweiterung ihrer medialen Kompetenzen. Mit Hilfe der Programme können Hausaufgaben, Bewerbungen alleine oderim Team bearbeitet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Cloudfunktion kooperatives Arbeiten im Unterricht und unterstützt damit die als 4K bezeichneten Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts: Kooperation, kritisches Denken, Kreativität und Kommunikation.
Im Bereich der Unterrichtsentwicklung ist die Fort- und Weiterbildung des Kollegiums ein wichtiger Schwerpunkt.
Am GSW ist man sich einig, dass die Vermittlung von Medienkompetenz Aufgabe aller Fächer ist und mit den obligatorischen Inhalten verknüpft werden soll.
Ausgerichtet am Medienpass NRW haben die Fachschaften mit der Erstellung von Unterrichtsreihen begonnen, die das gesamte Spektrum der zu vermittelnden Kompetenzen im Bereich Medien abdecken sollen.
Zudem erproben die Kolleginnen und Kollegen wie der Einsatz digitaler Tools für individuelles und selbstständiges Lernen genutzt werden kann.
Prävention
 |
| Die Klasse 7b absolvierte das Social-Network-Training. |
 |
Zum ersten Mal fand 2019 am Gymnasium Schloss Wittgenstein das Medienprojekt „Social Network Training“ (SNT) statt. Ausgehend von einem medienpädagogischen Ansatz hat das Projekt die Kompetenz und das Wissen junger Menschen in den Bereichen „Internet“ und „Social Media“ im Blick. Der Trainer des Ensible e.V., Yao Houphouet, sensibilisierte die Jugendlichen dafür, wie man sich gegen Gefahren im digitalen Raum schützt. In Zeiten sich ständig wandelnder Strukturen und Herausforderungen aus dem digitalen Raum ist das SNT ein ganzheitliches Präventions- und Interventionsprogramm und bildet junge Menschen zu Experten in digitaler Sache aus. Die im Projekt gewonnenen Kompetenzen und das breite Wissen im Bereich der Digitalisierung macht die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu wertvollen Multiplikatoren, nicht nur für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, sondern auch für Eltern und Geschwister.
Gefördert wird die Präventions-Interventions-Maßnahme durch den Lions Club Wittgenstein, in Verbindung mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord-Rhein-Westfalen. Um einen nachhaltigen und flächendeckenden Impuls in der Region zu setzen, haben sich der Lions Club gemeinsam mit dem Ensible e.V., Stützpunkt für Jugendkultur in NRW, und den acht weiterführenden Schulen der Gemeinden Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück auf den Weg gemacht, sich für die digitalen Fragestellungen der Gegenwart und der Zukunft zu wappnen.
Neben den Jugendlichen richtet sich das Projekt auch an die Eltern der Teilnehmenden. Durch abendliche Vortragsveranstaltungen bietet die Projektinitiative „Social Network Training“ Hilfestellungen, wie mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit der digitalen Welt umgegangen werden kann.
- Details
Kerngedanke dieses Projektes ist es, dass Schülerinnen und Schüler, die Defizite in einem oder mehreren Fächern aufweisen, Hilfe bekommen, um sich in ihrem Leistungsvermögen gezielt zu verbessern.
Update: Seit dem Schuljahr 2021/22 ist das Projekt unter neuer Leitung: Sina Becker-Gockel und Carsten Gemmer führen in Zukunft das Projekt "Schüler helfen Schülern" am GSW weiter. Sie stehen als Ansprechpartner für Interessierte zur Verfügung und vermitteln zwischen Tutoren und jüngeren Schülerinnen und Schülern.
 Über den Unterricht hinaus werden diese Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernweg begleitet und gefördert. Als Lernpaten wirken hier ältere Schülerinnen und Schüler, die eine qualifizierte Nachhilfe geben. Die Qualifizierung dieser Nachhilfe sichern wir dadurch, dass die Lernpaten eine methodische Schulung bekommen haben. Fachlehrer stehen ihnen mit weiteren Hinweisen, z. B. zur Materialauswahl, zur Verfügung. Das Projekt wurde von den Lehrerinnen Kristina Orth und Isabelle Schneller ins Leben gerufen. Zu Beginn des Schuljahres 21/22 übernahmen Sina Becker-Gockel und Carsten Gemmer die Betreuung des Projektes.
Über den Unterricht hinaus werden diese Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernweg begleitet und gefördert. Als Lernpaten wirken hier ältere Schülerinnen und Schüler, die eine qualifizierte Nachhilfe geben. Die Qualifizierung dieser Nachhilfe sichern wir dadurch, dass die Lernpaten eine methodische Schulung bekommen haben. Fachlehrer stehen ihnen mit weiteren Hinweisen, z. B. zur Materialauswahl, zur Verfügung. Das Projekt wurde von den Lehrerinnen Kristina Orth und Isabelle Schneller ins Leben gerufen. Zu Beginn des Schuljahres 21/22 übernahmen Sina Becker-Gockel und Carsten Gemmer die Betreuung des Projektes.
Sie begleiten die Lernpaten, indem diese u.a. in regelmäßigen Treffen die Möglichkeit erhalten, über ihren „Nachhilfe-Erfahrungen“ zu resümieren, Erfahrungen auszutauschen und neue Anreize zu erhalten.
Foto: Hintere Reihe von li. nach re.: Sina Becker-Gockel, Ramona Gelencsèr (Q2), Alena Hassler (10c), Carsten Gemmer. Vordere Reihe von li. nach re.: Ayaz Dulkadir (7b), Frederike Dirks (6a), Julius Büthe (7b).
Förderangebote
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 werden durch Lernpaten aus den Jahrgangsstufen 10 bis Q2 gezielt gefördert.
Die Förderung erfolgt in den Fächern
- Deutsch,
- Mathematik,
- Englisch,
- Latein,
- Französisch.
Lerngruppen
Ein wichtiger Aspekt des Projektes ist die Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit des gemeinsamen Lernens. Die Nachhilfe erfolgt einzeln oder zu zweit. Die Gruppen treffen sich regelmäßig einmal in der Woche in den Räumen des Schulgebäudes. Die Nachhilfe erfolgt i. d. R. für mindestens acht Wochen.
Vertrag
Die Nachhilfeschülerinnen und -schüler verpflichten sich regelmäßig und pünktlich zu den vereinbarten Terminen zu erscheinen und engagiert und diszipliniert mitzuarbeiten.
Die Lernpaten verpflichten sich die Nachhilfestunden effektiv und gewissenhaft vorzubereiten und zu gestalten und ihre Nachhilfeschüler nach besten Kräften zu unterstützen. Zum Abschluss erhalten die Tutoren ein Zertifikat über ihre Tätigkeit.
Anmeldung
Hier kannst du dich für das Projekt anmelden.
Weitere Informationen
Die folgenden Dateien enthalten alle notwendigen Informationen sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Eltern.
| Datei | Beschreibung | Dateigröße |
|---|---|---|
| In diesem Anschreiben findet Ihr alle grundlegenden Informationen für Interessierte | 207 KB | |
| In diesem Dokument finden interessierte Tutorinnen und Tutoren die grundlegenden Informationen über das Projekt "Schüler helfen Schülern". | 208 KB |